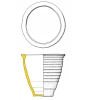Der Kachelofen erweist sich, im Gegensatz zum Kaminfeuer, in zweifacher Hinsicht als ideale Raumheizung. Er kann von einem gesonderten Raum aus beheizt werden und verhindert damit eine störende Rauchentwicklung in der Stube. Das Einfügen von Keramikteilen in die Ofenwandung vergrößert die Ofenoberfläche und erlaubt eine gleichmäßige Wärmeabgabe bei geringem Holzverbrauch. Nach dem Verlöschen des Feuers bleibt der Ofen durch die Speicherwirkung der Keramik noch lange Zeit warm.
Es kristallisierte sich bald die klassische Untergliederung eines Ofens heraus: in einen beheizbaren Feuerkasten und einen darüber liegenden Oberofen, der die Hitze des aufsteigenden Rauchs in Wärme umsetzte. Die gesamte Ofenkonstruktion stand auf einem gemauerten Sockel oder auf Ofenfüßen aus Holz, Keramik, Metall oder Stein. Wie sich aus zeitgenössischen Abbildungen ersehen läßt,1 wurde der Kachelofen von Anfang an nicht alleine als Raumheizung wahrgenommen. Er konnte von einer kniehohen, hölzernen Bank, der Ofenbank, umschlossen sein. In Bauernhäusern kann man gelegentlich eine Liegestatt auf, oder besser gesagt hinter dem Ofen beobachten. Der Ofenumbauung zuzurechnen sind darüber hinaus von der Decke herabhängende Stangen, an denen Kleidungsstücke oder Lebensmittel rußfrei getrocknet werden konnten. Ofeneinbauten aus Metall oder Keramik nutzten die Abwärme zum Garen von Speisen und zum Anwärmen von Wasser. Nicht unbeachtet sollten in diesem Zusammenhang auch Wärmefächer sein.2 Mit diesen fest im Ofenkörper verankerten Bauteilen war es möglich, die Wärmeabgabe des Ofens in begrenztem Umfang zu steuern.
Die bislang ältesten Ofenkacheln wurden in Form von Bechern und Schüsseln auf der schnelldrehenden Töpferscheibe geformt und im losen Verband in die aus Lehm bestehende Ofenwandung eingebaut. Bereits in der Frühzeit brachten die Töpfer trotz der vergleichsweise einfachen und einheitlichen Produktionsweise eine große Bandbreite an Formen hervor. Sie reicht von den Becher- und Schüsselkacheln bis zu ornamental verzierten Pilzkacheln und Tellerkacheln.3 Über das Aussehen der Öfen informieren zeitgenössische Belege, wie die Darstellung eines Kachelofens auf der Züricher Wappenrolle aus dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts.4
Bereits im 14. Jahrhundert setzten sich allmählich Napfkacheln als Ofenbesatz durch. Sie unterscheiden sich von ihren Vorgängern durch die quadratisch ausgezogene Mündung. Ihre Grundform erlaubt es, die gesamte Ofenoberfläche mit Kacheln zu besetzen und damit optimal zu vergrößern. Die Kacheln waren nun nicht mehr bloß Zutat zu einem Ofen, sondern dessen äußere Haut. Öfen mit Napfkacheln bilden im Untersuchungsraum das Gros der Ofenkacheln. Sie waren als preiswerte Raumheizung bis ins 18. Jahrhundert im Einsatz.
Mit der Aufwertung des Hausrates wurde auch der gotische Ofen in die allgemein wachsende Schmuckfreude einbezogen. Als idealer Bildträger entstanden in der Mitte des 14. Jahrhunderts etwa gleichzeitig Napfkacheln mit reliefierten Vorsatzblättern sowie Halbzylinderkacheln. Die hochrechteckige Halbzylinderkachel besteht aus einem auf der Töpferscheibe geformten Drittelzylinder. An seiner Vorderseite ist ein modelgepreßtes Vorsatzblatt angarniert. Sein durchbrochenes Innenfeld gibt den Blick auf den dahinter liegenden Halbzylinder frei. Ab dem 15. Jahrhundert verzierte man auch die Innenseite des Halbzylinders mit einem Relief. Etwas früher lässt sich der Einsatz von Halbzylinderkacheln beobachten, deren reliefierte Vorsatzblätter vollständig geschlossen waren. Der rückseitige Halbzylinder wurde in solchen Fällen mit einer nachträglich angebrachten Öffnung versehen. Die zwischen 1350 und 1500 entstandenen Halbzylinderkacheln lassen sich stilistisch mit Hilfe des auf ihnen angebrachten Maßwerks genauer datieren. Die meisten Kacheln dieser Art mit streng linearem Maßwerk sind in Dieburg gefertigte Halbzylinderkacheln vom Typ Tannenberg.5 Jedoch fanden sich in der Schweiz, in Südwestdeutschland und in Böhmen auch ältere Belegstücke dieses Kacheltypus.
Gegen 1500 wurden in Südwestdeutschland die Halbzylinderkacheln fast vollständig von den Blattkacheln verdrängt. Blattkacheln besitzen ein geschlossenes Vorsatzblatt. An ihrer Rückseite befindet sich anstelle eines Halbzylinders ein umlaufender, keramischer Steg, die Zarge.6 Sie verankert das Relief im Ofenkörper. Der Übergang zwischen Nischen- und Blattkachel erfolgte allmählich. Noch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stattete man die Rückseite einer Kachel mit einem rückseitig aufgeschnittenen Halbzylinder aus. Die senkrechte Aussparung war notwendig, um den Wärmeaustausch zu gewährleisten.
Die ewige Suche nach der richtigen Terminologie
Mit der systematischen Erschließung von Kachelbeständen ergab sich bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Notwendigkeit einer korrekten Ansprache der unterschiedlichen Kachelformen. Den Anfang bildete die 1910 erschienene Dissertation von Sune Ambrosiani.7 Er stellte die Kacheln in monteliusscher Manier in eine chronotypologische Reihe. Die „primitivsten“ Formen bilden in Entsprechung zu der hinter der Terminologie stehenden Grundeinstellung den Anfang einer Reihe. Ambrosiani setzte mit seinem vergleichsweise bescheidenen Œuvre eine Richtlatte, an der sich die Autoren bis in die 1980er Jahre orientierten.8 Die verstärkt kunsthistorische Betrachtungsweise, beispielsweise durch Konrad Strauss und Rosemarie Franz, fand sich in dieser Seriation bestätigt. Werner Endres und in der Folge Hans-Georg Stephan und Matthias Henkel stießen im Zuge ihrer archäologischen und volkskundlichen Materialerfassungen auf deutliche Schwachstellen. Eine für den gesamten Verbreitungsraum der Ofenkeramik verbindliche Terminologie unter Berücksichtigung aller regionalen Besonderheiten, die Formen und die Typochronologie betreffend, erwies sich als nicht umsetzbar. Dennoch bemühte sich eine Sektion des Internationalen Hafnereisymposiums unter Werner Endres seit den 1990er Jahren um ein dem Keramikleitfaden entsprechendes verbindliches Gliederungssystem. Matthias Henkel (1999)9 und Heinz-Peter Mielke (2007)10 legten ihre Vorschläge vor und wandten die von ihnen entwickelte Typologie auf Ofenkeramiken an. Eva Roth Heege gilt der Verdienst, sich gemeinsam mit Andres Heege in dem von ihr 2012 herausgegeben Sammelband am intensivsten mit der Verstetigung einer Terminologie angenommen zu haben.11 Die von ihr definierten Formen wurden einzeln beschrieben, in ein Ordnungssystem eingebunden und mit Beispielen in Form von Fotografien und Zeichnungen hinterlegt. Jüngste Überlegungen stammen aus der Feder von Stephanie Bilz. Diese nahm sich 2023 im Rahmen ihrer Dissertation zu mittelalterlich Ofenkeramik in Sachsen dem Themenbereich an.12
Auch für die vorliegende Website dient das Werk von Roth Heege als Orientierung. Allerdings scheint es sinnvoll und notwendig, einige dort vorgenommene Klassifizierungen abzuwandeln und/oder anders anzusprechen. Die Abweichungen sind meist gradueller Natur. Eine Allgemeinverbindlichkeit der in dieser Site zur Anwendung kommenden Terminologie ist nicht angestrebt.
Die Arbeit von Eva Roth Heege ist in der schweizerischen Terminologie und Typologie tief verankert. Beispiele dafür sind Begriffe wie „Rapportmuster“ anstelle von „Tapetendekor“ oder „Rumpf/Tubus“ anstelle von „Zarge“. Auch ist die Stringenz an der Orientierung an den Herstellungstechniken einer Ofenkachel stellenweise zu überdenken. Die Gestaltung technischer Elemente, wie die Ausbildung der Rückseiten, bestimmt die hier angewandte Begrifflichkeit. Kacheln mit keramischen Halb- oder Drittelzylinder werden als Halbzylinderkacheln bezeichnet, unabhängig davon, ob diese ein durchbrochen oder geschlossen gearbeitetes Vorsatzblatt aufweisen. Blattkacheln definieren sich diesem Typologieansatz folgend über die auf der Rückseite angesetzte Zarge. Eckkacheln Roth´scher Definition werden in „furnologia“ in über Eck geführte Blattkacheln und in (echte) Eckkacheln unterteilt.
Harald Rosmanitz, Partenstein 2020, erweitert und überarbeitet 2023
Weiterführende Literatur:
Alexandre-Bidon, Danièle (2000): Le poêle. Une histoire en images (fin XVe – XVIIe siècle). In: Annick Richard; Jean-Jaques Schwien (Hg.): Archéologie du poêle en céramique du Haut Moyen Âge à l’époque moderne. Technologie, décors, aspects culturels. Actes de la table ronde de Montbéliard 23-24 mars 1995 (Revue Archéologique de l´Est 5), Dijon, S. 193–207.
Ambrosiani, Karl Sune Fredrik (1910): Zur Typologie der älteren Kacheln, Stockholm.
Bilz, Stefanie (2023): Studien zur Ofenkeramik des Mittelalters in Sachsen basierend aus archäologischen Quellen. (masch. Diss.), Halle (Saale).
Elsenheimer, Jürgen (2020): „Menzcher kacheln“. Ofenkacheln meist originär aus dem mainzischen Dieburg. Ein Beitrag zur Geschichte des Kachelofens im Allgemeinen vom 12. bis 16. Jh. mit Schwerpunkt auf gotischen Kacheln und Öfen aus den mittelalterlichen Verbraucherregionen Südwestdeutschlands und seiner Randgebiete. (masch. Manuskript), Mainz.
Flühler-Kreis, Dione (2003): Die Stube als sakraler Raum. Das Familienportrait des Züricher Landvogts von Greifensee, Hans Conrad Bodmer. In: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 60, S. 211–220.
Franz, Rosemarie (1981): Der Kachelofen. Entstehung und kunstgeschichtliche Entwicklung vom Mittelalter bis zum Ausgang des Klassizismus, 2. verb. u. verm. Aufl., Graz.
Hazlbauer, Zdeněk (2003): Dobová znázornění rozličných kachlových kamen s přihlédnutím k jejich zřízení v různých místnostech stavebních objektů. [Zeitliche Darstellung der verschiedenen historischen Kachelöfen mit Berücksichtigung ihrer Platzierung in verschiedenen Räumen der Lokalität]. In: Svorník 1, S. 169–186.
Hefner, Joseph von; Wolf, Johann Wilhelm (1850): Die Burg Tannenberg und ihre Ausgrabungen, Frankfurt am Main.
Henkel, Matthias (1999): Der Kachelofen. Ein Gegenstand der Wohnkultur im Wandel. Eine volkskundlich-archäologische Studie auf der Basis der Hildesheimer Quellen. (masch. Diss.), Nürnberg.
Henkel, Matthias (2012): Abbild oder Sinnbild? Kachelöfen in historischen Bildquellen als Grundlage von Ofenrekonstruktionen. In: Eva Roth Heege (Hg.): Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 39), Basel, S. 151–167.
Honold, Konrad (1995): Die Entstehung der Wappenrolle von Zürich und ihre Bedeutung für Vorarlberg, Dornbirn.
Kluttig-Altmann, Ralf (2014): Auf breiter Basis. Fundanalysen aus Wittenberg. In: Harald Meller (Hg.): Mitteldeutschland im Zeitalter der Reformation (Forschungsberichte des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 4), Halle an der Saale, S. 177–192.
Merz, Walther; Hegi, Friedrich Hermann (Hg.) (1930): Die Wappenrolle von Zürich. Ein heraldisches Denkmal des vierzehnten Jahrhunderts, Zürich, Leipzig.
Mielke, Heinz-Peter (2007): Kachelofen – Ofenkachel – Herdkachel – Kachelherd. Zur Nomenklatur keramischer Ofen- und Herdelemente. Definitionen und Zuordnungen. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, S. 97–102.
Prüssing, Peter (2013): Mittelalterliche und frühneuzeitliche Ofenkacheln aus Dieburg. Ein Beitrag zur Geschichte des Kachelofens. In: Winfried Wackerfuß (Hg.): Beiträge zur Erforschung des Odenwaldes und seiner Randlandschaften VIII, Breuberg/Neustadt, S. 241–300.
Rosmanitz, Harald (2015): Die Ofenkacheln vom Typ Tannenberg. Eine spätgotische Massenproduktion im Spannungsfeld von Produzent und Konsument. In: Stefan Hesse; Tobias Gärtner; Sonja König (Hg.): Von der Weser in die Welt. Festschrift für Hans-Georg Stephan zum 65. Geburtstag (Alteuropäische Forschungen NF 7), Langenweißbach, S. 355–373.
Rosmanitz, Harald (2022): Reliefierte Ofenkacheln des Spätmittelalters und der Neuzeit aus dem Spessart im Spannungsfeld von Motivgeber, Handwerker und Verbraucher. Möglichkeiten und Grenzen einer induktiven Kontextualisierung. (masch. Diss.), Partenstein.
Roth Heege, Eva (Hg.) (2012): Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 39), Basel.
Roth Kaufmann, Eva; Buschor, René; Gutscher, Daniel (1994): Spätmittelalterliche reliefierte Ofenkeramik in Bern. Herstellung und Motive (Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern), Bern.
Schmitt-Böhringer, Astrid (2008): Burg Tannenberg bei Seeheim-Jugenheim, Lkr. Darmstadt-Dieburg. Eine spätmittelalterliche Ganerbenburg im Licht der archäologischen Funde (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 151), Bonn.
Špaček, Jaroslav; Skružný, Ludvík (2002): Vývoj kachlových kamen ve svědectví ikonografického materiálu a národopisných paralel. [Entwicklung der Kachelöfen im Zeugnis der ikonographischen Quellen und der ethnographischen Parallelen]. In: Archaeologia historica 27, S. 535–553.
Strauss, Konrad (1968): Der Kachelofen in der graphischen Darstellung des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Keramos. Zeitschrift der Gesellschaft der Keramikfreunde e.V. Düsseldorf (39), S. 22–38.
- Alexandre-Bidon 2000; Flühler-Kreis 2003; Hazlbauer 2003; Henkel 2012; Špaček/Skružný 2002; Strauss 1968
- Elsenheimer 2020, S. 52-55; Kluttig-Altmann 2014, S. 183-186; Rosmanitz 2022, S. 88-97
- Die Ansprache der Kachelformen orientiert sich am dem 2021 von Eva Roth Heege herausgegebenen Terminologie (Roth Heege 2012). Hinzu kommen Modifikationen des Autors (siehe dazu Rosmanitz 2022, S. 20-25).
- Honold 1995; Merz/Hegi 1930
- Hefner/Wolf 1850; Prüssing 2013; Rosmanitz 2015; Schmitt-Böhringer 2008
- Die Zage wird auch als Tubus bezeichnet (Roth Kaufmann et al. 1994, S.24-42).
- Ambrosiani 1910
- Federführend war dabei Franz 1981, S. 24-37
- Henkel 1999
- Mielke 2007
- Roth Heege 2012
- Bilz 2023, S. 98-158